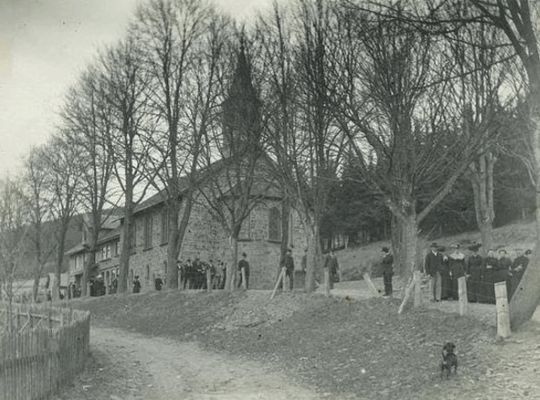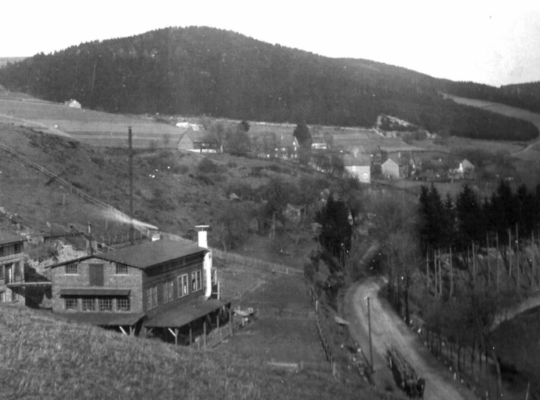Audio:
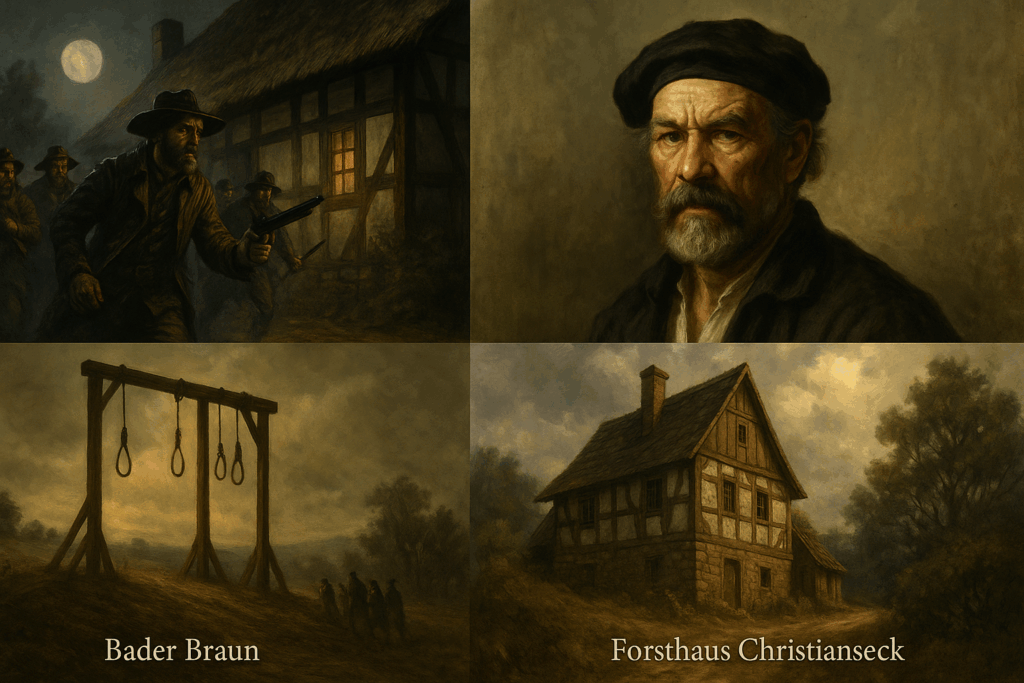
Die Schwarzenauer Räuberbande
In der Mitte des 18. Jahrhunderts war das Wittgensteiner Land ein Dorado für
Diebe und Banden. Schon im Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) war die
Bevölkerung von marodierenden Soldaten verschiedener Nationalitäten
bestohlen und beraubt worden, und dieser Terror setzte sich nun fort. Besonders
unrühmlich machte die Schwarzenauer Räuberbande von sich reden. Das ganze
Land – von Melbach über den „Schlechten Boden“ bis weit ins Hessenland – soll
vor ihr gezittert haben.
Räuberhauptmann war der Bader (Barbier) Braun aus Laasphe. Dabei war kaum
zu glauben, dass er als ehrbarer Bürger überzeugend gar den Aufstieg zum
Hofbarbier von Graf Ludwig von Wittgenstein geschafft hatte, so dass sich selbst
der Graf vom Bandenoberhaupt frisieren und rasieren ließ.
Die Bande soll bis zu 32 Mann stark gewesen sein. In dieser vollen Stärke oder in
kleineren Trupps unternahmen die Männer ihre nächtlichen Streifzüge. Durch das
Schwärzen ihrer Gesichter und allerlei Verkleidung und Vermummung versuchten
sie unerkannt zu bleiben, denn bei ihrem wüsten Treiben hinterließen eine Spur
von Blut- und Gräueltaten.
Lange Zeit konnte die Bande ungehindert ihrem „Handwerk“ nachgehen, denn
überall fand sie ihre Helfershelfer. Aus Angst und Furcht vor den Grausamkeiten,
aber auch durch Versprechungen und Belohnungen wurden den Räubern
geheime Pforten geöffnet und Zufluchtsstätten geboten. Dadurch konnten sie
sich dem Auge des Gesetzes entziehen und ihrem Treiben Vorschub leisten. So
fanden sie in der Moose/Weidenhausen und auch an anderen Orten immer
wieder Freunde, bei denen sie in Ruhe beraten konnten, wo fette Beute zu
machen sei.
Häufig scheiterte die Ausführung der Taten an der erhöhten Wachsamkeit im
Bereich der Tatobjekte. War das Geld versteckt oder vergraben, so mussten die
Räuber erfolglos wieder abziehen. An anderer Stelle setzten sich die Überfallenen
entschieden zur Wehr und ließen die Räuber nicht mit heiler Haut davonkommen.
So musste ein Bösewicht bei einem Einbruch in das Haus von Karl Hüster auf dem
Struthbach sein Leben lassen, denn eine Kugel hatte dem Verbrecherleben ein
Ende gesetzt. In dem Teichkopf verscharrte man den Toten am anderen Tage, und
noch lange Jahre wies ein Steinhaufen auf die Stelle, wo er seine letzte
Ruhestätte fand.
Mit Vorliebe stattete die Bande den Einzelgehöften nächtliche „Besuche“ ab. Wo
Geld vermutet oder gewittert werden konnte, hatte man guten Grund, auf der
Hut zu sein. Nicht einmal die Forsthäuser waren sicher. Die dort befindlichen
Forstkassen ließen die Räuber die doppelte Gefahr übersehen. Verwegen bot
man den sicheren Schützen die Stirn und scheute weder wachsame Hunde noch
die Kugel der Grünröcke.
Oberförster Müller in Christianseck erhielt auf diese Weise öfter nächtlichen
Besuch. Aber tapfer quittierte der Alte die Raubversuche mit Büchse und Blei.
Immer wieder musste die Bande ohne die Forstkasse im Dunkel des Waldes
verschwinden. Als er sie wieder einmal mit blutigen Köpfen heimgeschickt hatte,
brachen sie bei Feige auf dem Burghard’schen Hof ein, um nicht mit leeren
Händen heimzukehren. Die Bewohner verrammelten die Türen und flüchteten
auf den Speicher. Dann begann ein regelrechtes Gefecht und manche Kugel drang
durch Fenster und Tür ins Gebäude, aber auch in Richtung der Räuber. Für die
Belagerten eine unheimliche Nacht. Schließlich zogen die Räuber ab.
Einen Toten hatten sie zurücklassen müssen, einen Verwundeten schleppten sie
dagegen mit und brachten ihn auf den Böhling bei Schwarzenau. Als er dort sein
Ende nahen fühlte, begehrte er nach einem Geistlichen, wohl um sein elendes
Gewissen zu erleichtern. Der Hauptmann Braun aber hielt dieses Begehren mit
Recht für gefährlich und erdrosselte kurzerhand den Sterbenden. Man begrub ihn
in einem Steinbruch an der Grubenbracht, wo er 1819 ausgegraben wurde.
Auch ins hessische Hinterland dehnte die Bande ihre Streifzüge aus. Dort sollen
sie im Grund von Eifa den Großvater des Gerichtsrats Völkel, den L. Winter, der
auf dem Weg zu einer Messe in Frankfurt war, überfallen und ausgeplündert
haben. Schließlich erhielt der Beraubte noch einen Schuss in den Nacken und
starb.
In Schwarzenau überfiel die Räuberbande u. a. auch das Haus der Witwe
Prätorius (8. Mai 1745). Da es im Vorfeld bereits Hinweise auf einen möglichen
Überfall gegeben hatte, hielten die Bewohner Wache. So gelang es den
Überfallenen, unter ihnen auch der Pietist und Mystiker Marsay, sich im Keller
des Hauses zu verstecken, als die Räuber über eine Leiter in das Zimmer der
Jungfrau Frensdorff einstiegen. Durch die Schüsse der Räuber waren die
Nachbarn auf die Tat aufmerksam geworden und eilten den Bedrängten zu Hilfe.
Aber selbst bei ihrer Flucht drohten die Übeltäter noch den zu Hilfe Geeilten mit
den Worten: „Wenn wir fertig sind, wollen wir auch an euch.“
Nach zahlreichen Diebstählen, Brandstiftungen und Mordtaten schlug aber auch
dieser Bande die Stunde. Räuberhauptmann Braun wurde auf dem Schloss
Laasphe festgenommen – wohl kurz nachdem er ein letztes Mal den Grafen
rasiert hatte. Seine Helfershelfer Paul Eckel und ein Kesseller wurden in
Schwarzenau verhaftet.
Da die Gefangenen nicht gestehen und die anderen verraten wollten, wurden
unter Zuhilfenahme von Drohungen und Folter die Namen der Mittäter bekannt.
Wer sich nicht rechtzeitig durch Flucht der Verantwortung entziehen konnte,
wurde „gefänglich eingezogen“.
Fünf Übeltäter, Hauptmann Braun, Johann Paul Eckel, Georg Imbach, Johannes
Betzel und Nikolaus Arnold, wurden am 19. Januar 1770 am Galgenberg zu
Puderbach durch den Strang hingerichtet. Namentlich die Täterin Margarete
Neuhaus, die Schwester des Nikolaus Arnold, wurde durch das Schwert gerichtet.
Sie hat wohl noch bis zu ihrem Ableben auf den Richtplatz unflätige Äußerungen
von sich gegeben, indem sie den Geistlichen, der ihr Trost zusprechen wollte,
einen dummen Pfaffen nannte und sich über einen Mann in Dotzlar, den sie
gequält hatten, noch unmittelbar vor ihrer Hinrichtung lustig machte.
Nach den Hinrichtungen soll es dann am Galgenberg bei Puderbach in der Nacht
noch zu einem tragischen Ereignis gekommen sein: Ein Reiter aus Biedenkopf, der
bei Dunkelheit und Regen vorbeikam, erlaubte sich einen makaberen Scherz mit
dem erhängten Räuberhauptmann. Er kannte Braun von Aufenthalten in Laasphe
und rief ihm die Frage zu: „Braun, willst du mitkommen?“ Als er dann die
Antwort: „Ja, warte auf mich“ und ein lautes Scheppern von Metall hörte, trieb er
sein Pferd an und ritt vor Angst schreiend nach Biedenkopf, wo sein Pferd tot
zusammengebrochen sein soll.
Das alles ist aus den Berichten des Sensenhändlers Braun bekannt. Dieser hatte
sich wegen des Regens Nahe des Galgens untergestellt und meinte, der Reiter
habe ihn mit Namen angesprochen, worauf er geantwortet hatte und unter
lautem Klirren der mitgeführten Sensen aufgesprungen war.
Zusammengestellt aus Aufsätzen und Berichten in folgenden Publikationen:
Thielicke, August: Mitteilungen des Vereins für Geschichte und
Volkskunde Wittgensteins, Heft 2, Weidenhausen und Rheine. 1914/15.
Bauer, P.: Das schöne Wittgenstein, Heft 3 u. 4. 1928.
Klammer, Jost: Der Perner von Arfeld. Kirchengeschichte im Raum Arfeld
vom Jahre 800 bis 1945 nach Christus. 1983.
Wied, Hans: Sagen und Märchen aus dem Hinterland. Bad Laasphe,
Biedenkopf. 1987.
Bilder KI generiert
Text von Karl-Heinz Bender
Audio erstellt mit NotebookLM